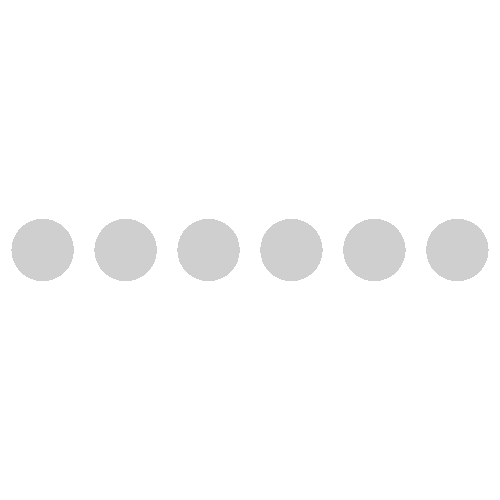chstens auf zeitweiligen Wider-
stand oder, wie man optimistischer sagen ko?
stand oder, wie man optimistischer sagen ko?
Weininger - 1923 - Tod
gen, mag man an den doppeltfetten
Lettern ermessen -- dass die Platon'sche Unter-
scheidung vom Seienden und Nicht-Seienden voll-
kommen auf M und W passe: Das Weib ist nicht
nur nichts, sondern u? berhaupt nicht.
Diese Verquickung philosophischer Anschau-
ungen mit dem Problem der Geschlechter hat durch-
aus den Charakter eines Witzes in dem fru? her er-
o? rterten Sinne. Ich kann mir sehr gut vorstellen,
dass jemand darauf mit lebhafter Heiterkeit reagiert.
Viele freilich werden bei jener trostlosen Offenbarung
u? ber W eine lebhafte Gefu? hlsbefriedigung empfinden;
sie werden erleichtert aufatmen, freudig bewegt, dass
endlich einer gekommen ist, ? der es ihnen (W na? m-
lich) gesagt hat". Das ist freilich eine etwas ver-
da? chtige Art, Erkenntnis zu begru? ssen. Erkenntnis
soll den Geist befriedigen, aber nicht das Gemu? t.
Allerdings mu? sste sie dazu auch dem Geist ent-
stammen, nicht einem verbitterten Herzen.
Ich habe fru? her dargelegt, unter welchen Um-
sta? nden es besonders ha? ufig zu anorganischen,
witzigen Seelengebilden kommt: wenn na? mlich mit
diesen Gebilden ein lebhaftes Gemu? tsbedu? rfnis --
die unterdru? ckten sind die lebhaftesten -- befriedigt
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 25
werden soll. Dieses Bedu? rfnis liegt nun bei Weininger
ganz offen zutage. Ein anderer an seiner Stelle --
und wie viele nicht in seinem Alter! -- ha? tte ein-
fach gesagt: Die Weiber sind mir Luft. Etwas anderes
wollte Weininger auch gar nicht sagen. Aber er
konnte es, zu seinem Unglu? ck, viel scho? ner sagen.
Die banale vera? chtliche Phrase verband sich unter
dem dru? ckenden Bedu? rfnis abzureagieren mit seinem
philosophischen Wissen und so konnte er seinem
Groll in der Art Ausdruck geben, dass er sagte:
W ist u? berhaupt nicht. Mit der U? bertragung der
Platon'schen Kategorie auf W war aber noch eines
gewonnen: Wer behauptet, die Weiber seien ihm
Luft, der behauptet etwas Subjektives; wer behauptet,
sie seien nicht, etwas Objektives. Das war es, was
Weininger ein so offenkundiges Triumphgefu? hl be-
reitete: Er konnte beweisen, wo die andern nur
schimpfen konnten. Einen Schimpf kann man zuru? ck-
geben, vor einer wissenschaftlich bewiesenen Tat-
sache dagegen muss jede Gegenrede verstummen.
Dass Weininger kein uninteressierter Denker
war, lehrt wohl ein Blick in seine Schriften. Ein
Denker darf aber kein anderes Ziel vor Augen haben
als Denkergebnisse. Jedes Interesse -- Ehrgeiz,
Liebe, Hass, Streben aller Art -- fa? lscht das Denken
unfehlbar in der geschilderten Weise. Unter dem
Druck eines Gemu? tsbedu? rfnisses ko? nnen zwar allerlei
pra? chtige, bestechende, blendende Bildungen zu-
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 26
sta? nde kommen, aber keine echten Gedanken. Es
kommt dabei wohl eine Wahrheit heraus, aber nicht
u? ber die Welt, sondern u? ber eine leidende Seele.
Was die Bildung unechter Gedanken bei Weininger
begu? nstigte, das war sein ungewo? hnlicher Reichtum
an Kenntnissen aller Art. Dieser Reichtum ermo? g-
lichte ihm massenhafte, verfu? hrerische Kombinationen
zwischen den Vorstellungen ganz entlegener Ge-
biete; er war in allen Fa? chern der exakten Natur-
wissenschaft bewandert, er wusste in medizinischen
Fragen ausgezeichnet Bescheid, von den Geistes-
wissenschaften gar nicht zu reden. Setzte sich nun
in ihm aus irgend einem Gefu? hlsmotiv eine Meinung
fest, so war im Handumdrehen eine Kombination
von Vorstellungen da, welche ihm seine Meinung
bewies. Besonders in den ? letzten Dingen" ist dieses
Verfahren deutlich zu konstatieren: wie ihm ganz
a? usserliche Analogien zwischen zwei Tatsachen als
Beweis einer vorgefassten Meinung genu? gen. Solche
traumartige Bildungen hatten fu? r ihn die Evidenz
von unumsto? sslichen Wahrheiten.
Dies wird nun viele bei einem Geist von so
grosser Genialita? t, also von der Fa? higkeit zu wirk-
lichen Wahrheiten, befremden. Man hat Weininger
sehr unrecht getan, wenn man unter Hinweis auf
seine witzartigen Gedanken, seinem gesamten Denken
jeglichen Erkenntniswert absprach. Davon kann keine
Rede sein. Man muss da scharf scheiden und es
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 27
la? sst sich, wie ich gezeigt habe, auch scharf scheiden.
Allein viele seiner Behauptungen und gerade solche,
auf die er am meisten hielt, sind vo? llig unhaltbar
und da fragt es sich, wie denn ein Mensch von
solcher Tiefe und solchem Scharfsinn zu ihnen ge-
langen konnte. Die Antwort ist wieder durch die
Tatsache schon mitgegeben, dass Weininger bei
seinem Denken ha? ufig seelische Interessen ver-
folgte. Solche Interessen fa? lschen nicht nur das
Denken," sondern sie verblenden auch gegen diese
Fa? lschung. Weininger hing gerade am Unhalt-
barsten mit der gro? ssten Liebe; die vermeintlichen
Wahrheiten befriedigten ihm eben seine Gemu? ts-
bedu? rfnisse und diese u? berwogen in den letzten
Jahren seines Lebens weitaus die rein geistigen Be-
du? rfnisse. Die Wonne, welche ihm seine Gedanken
verschafften, nahm er als eine Bu? rgschaft ihres Wahr-
heitsgehaltes hin; er war von ihrer Wahrheit u? ber-
zeugt, weil sie ihm Freuden spendeten, so gross wie
sie nur dem Gemu? t zuteil werden. Es erging ihm
wie den Eltern, die von der Gu? te und Gescheitheit
ihrer Kinder u? berzeugt sind, weil sie an ihnen Freude
haben. Interessen fa? lschen das Denken und tru? ben
das Urteil, vor allem die Selbstbeurteilung. Weininger
war fu? r einen reinen Denker, wie seine Probleme
einen erforderten, viel zu jung. Es war, in seinem
Alter, eine Vermessenheit, die reine Wahrheit finden
zu wollen, eine Vermessenheit, die er mit dem Tode
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 28
gebu? sst hat; ha? tte er die U? berzeugung zu opfern ver-
mocht, dass seine Anschauungen durchwegs die reine
Wahrheit enthalten, so wa? re er leicht zu retten ge-
wesen. Aber der erste Fehler, die Vermessenheit, zog
den zweiten Fehler, den Starrsinn, nach sich und
so war dem U? bel schliesslich nicht mehr zu steuern.
Ich werde spa? ter noch ausfu? hrlich klarlegen,
dass Weininger eigentlich an einem Irrtum zugrunde
gegangen ist. Dieselben Gemu? tszusta? nde, welche
aus seinen Vorstellungen ku? hne und bestechende
Kombinationen auffu? hrten, verleiteten ihn zum un-
bedingten Glauben an diese Kombinationen. Er
konnte von den Ideen, die ihm als go? ttliche Ein-
gebungen erschienen, wa? hrend sie nur eine Mache
der Da? mone in seinem Herzen waren, nicht mehr
los, er zwang sein Leben in Regeln, fu? r die es
nicht geschaffen war, bis er schliesslich dem Glauben
an sich selber zum Opfer fiel.
Eine Folge der Gemu? tsinteressen ist auch die
stellenweise so gla? nzende Dialektik in ? Geschlecht
und Charakter". Nichts fu? hrt zu einer so deutlichen
Charaktersierung des Stils, als das Verha? ltnis eines
Autors zu seinen eigenen Gedanken. Advokatorische
Beredsamkeit und namentlich Scharfsinn bekundet
immer nur der Interessierte, der, wie es zum In-
teressierten schon geho? rt, Gegner befu? rchtet und
deren Einwendungen im vorhinein beka? mpft. Die
Wahrheit tritt in ganz schlichtem Gewa? nde vor die
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 29
Welt hin. Es bedarf keiner Fingerzeige und Aus-
rufe, damit man sie bemerkt und achtet. Fu? r eine
Wahrheit echauffiert sich ihr Autor nie; sein In-
stinkt sagt ihm, dass sie ihren Weg so sicher nehmen
wird wie ein wohlgeratenes Kind. Anders ist es
bei den auf die angegebene Weise entstehenden
Scheinwahrheiten. Sie sind von vornherein nichts als
tru? gerische Kombinationen, es ist daher nur konse-
quent, wenn man viel Mu? he aufwendet, um sie ins
rechte Licht zu setzen.
Fu? r die Beurteilung von Weiningers Hauptwerk
ist nicht zuletzt dessen Wirkung von Wichtigkeit.
Diese Wirkung la? sst sich eigentlich erst auf Grund
der eben vorgenommenen Unterscheidung zwischen
echten und Scheinwahrheiten verstehen. Scheinwahr-
heiten sind nichts anderes als Gemu? tsa? usserungen,
die demgema? ss auch vor allem auf das Gemu? t des
Lesers, nicht auf seinen Verstand wirken. So stu? rmische
Zustimmung und Ablehnung, wie sie Weiningers An-
sichten fanden, werden einer Einsicht nie zuteil.
Einsichten rufen u? berhaupt nie eine Parteiung
hervor; sie stossen ho?
chstens auf zeitweiligen Wider-
stand oder, wie man optimistischer sagen ko? nnte,
sie brauchen eine Inkubationsfrist. Weininger hat
dagegen, mit einem Schlage, die einen entzu? ckt, die
andern empo? rt. Gleichgestimmte haben ihn als
Befreier von schwerlastendem Gemu? tsdruck begru? sst,
Andersgestimmte als Seelensto? refried zuru? ckge-
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 30
wiesen. Durch eine wirkliche Einsicht werden die
Gemu? ter nicht in Aufruhr gebracht; durch eine
falsche Einsicht wird der Aufruhr einer Seele vielen
Seelen mitgeteilt, so ist der Sachverhalt.
Weiningers Buch ist furchtbar genannt worden.
Auch das ist sehr bezeichnend. Es gibt keine furcht-
baren Wahrheiten. Die Wahrheit wirkt immer be-
lebend, wohltuend. Die Wahrheit, sei 's nun u? ber eine
naturwissenschaftliche Frage oder u? ber den er-
habensten Gegenstand, ist ein Teil der go? ttlichen
Offenbarung, nicht im Sinn irgend einer kirch-
lichen Dogmatik, sondern naturphilosophisch ge-
nommen; es widerspricht dem Begriff der Wahr-
heit, dass sie wie eine furchtbare Enthu? llung wirkt.
Dass viele von Weiningers Behauptungen geradezu
niederdru? ckend wirken, ist zweifellos, aber nur, weil
sie unter der Etikette von Erkenntnissen die Ge-
fu? hle einer zu Tode verzweifelten Seele a? ussern.
Nicht von der Wahrheit kommt die schaurige Ka? lte,
die einem aus manchen Seiten von ? Geschlecht
und Charakter" entgegenweht, sondern von der
Selbstmordstimmung, in der diese Seiten geschrieben
sind und die sich dem Leser unwillku? rlich mitteilt.
Das fehlte noch, dass man die Forschung betreiben
muss unter Zittern und Bangen vor dem, was
herauskommt! Nein, die Forschung ist der fro? h-
lichste Gottesdienst. Und die Erkenntnis, die dabei
zutage kommt, ist unter allen Umsta? nden tro? stlich
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 31
und heilkra? ftig. Und wenn sie es nicht ist, wenn
sie krank und lebensu? berdru? ssig macht, so verra? t
sie dadurch ihre unechte Abkunft.
Man kann den Tadel, welchen ich hier gegen
gewisse Teile von Weiningers Werk erhoben habe,
in ein einziges Wort zusammenfassen: es ist zum Teil
rein perso? nlich. Nach einem richtigen Gedanken-
werk darf man keine Biographie schreiben ko? nnen.
Man soll nicht einmal ahnen ko? nnen, wie dem Ver-
fasser dabei zumute war, geschweige denn zur
Annahme bestimmter Erlebnisse gelangen. Am Werke
des Denkers sollen Zusta? nde den allergeringsten
Anteil haben. Der Denker soll sich hierin vom
Ku? nstler unterscheiden, bei dem die Verwendung des
Perso? nlichen zum Fach geho? rt, dem es ja vor allem
darum zu tun ist, die Welt mit seiner Perso? nlichkeit
bekannt zu machen, der sich aber auch nicht einbildet,
die reine, allgemein gu? ltige Wahrheit zu sagen. Ein
philosophisches Werk soll nicht einmal durch den Ton,
in dem es geschrieben ist, ein Bekenntnis ablegen.
Den Freudenaffekt, das frisch fro? hliche svgrjxa darf
man daraus vernehmen, sonst nichts. Pru? ft man Wei-
ningers Werk auf diese Regel hin, so findet man,
dass es vielfach nur grandiose gelehrte Variationen
entha? lt u? ber Themen, die andere in lyrischen Ge-
dichten, Dramen und Symphoniesa? tzen behandeln.
Ich habe u? ber alle diese Punkte mit Weininger
seinerzeit viel gesprochen. Er konnte es -- aller-
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 32
dings erst spa? ter -- nicht leiden, wenn man den
Inhalt eines Werkes psychologisch erkla? rte, das heisst
aus den Lebensschicksalen seines Verfassers. Nament-
lich an ein Mal erinnere ich mich, wo er sehr heftig
wurde, als ich dieses Verfahren auf Nietzsche an-
wandte. Nun sind ja Erlebnisse eine unbedingte Vor-
aussetzung fu? r geistige Produktion irgendwelcher
Art. Der Gedanke ist der Abschluss des Erlebnisses
und sein Ertrag. Dieser Hergang ist ganz in der
Ordnung. Unstatthaft ist es nur, dass das Erlebnis
eine fremde Gedankengruppe beeinflusst. Wenn
jemand durch ein gewaltiges Elementarunglu? ck zu
Gedanken u? ber das Weltregiment angeregt wird,
so ist das natu? rlich; wenn er aber, etwa infolge
unglu? cklicher Liebe, theologische Spekulationen be-
ginnt, die fu? r Gott ungu? nstig ausfallen, so ist das
verschroben. Ein Werk psychologisch erkla? ren, heisst
ja nicht, ihm jeglichen Wert absprechen, sondern
nur, jenen Faktor aufsuchen und eliminieren, der
mit der Wahrheit absolut nichts zu tun hat.
Es wa? re unbillig, von jedem Denker eine innere
Unabha? ngigkeit zu verlangen, wie sie nur sehr
wenigen gnadenweise zuteil wird. Wenn aber jemand
verlangt, dass man alle seine Anschauungen als un-
bedingte Wahrheit hinnimmt, dann ist man wohl nach-
zuforschen berechtigt, unter welchen Bedingungen
etwa seine ? Wahrheiten" entstanden sind; und man
wird gerade in diesem Fall auch immer Bedingungen
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 33
finden. Bei Werken der Kunst ist die psychologische
Forschung -- wenn sie als wesentlicher Bestandteil
vertieften Kunstgeniessens ausgegeben wird -- aller-
dings unstatthaft; sie ist dort nichts als eine wissen-
schaftlich drapierte besondere Art von Lu? sternheit.
Aber bei einem Denker zeugt es von schlechtem
Gewissen, wenn er sich gegen eine psychologische
Untersuchung verwahrt. In der Tat, wenn beim
Ku? nstler das Erlebnis, etwa durch einen spa? ter publi-
zierten Briefwechsel, offenbar wird, so a? ndert das
an der Wertung des Kunstwerkes nicht das ge-
ringste; dagegen verlieren eines Mannes Gedanken
u? ber die Geschlechtsliebe sehr an Kredit, wenn aus
nachgelassenen Rezepten hervorgeht, wie schlechte
Erfahrungen er im Leben gemacht hat. Unglu? ck
macht manchmal weise; noch o? fter aber beschra? nkt
und ungerecht.
Wie Weininger bei seinen Forschungen oft zu-
wege ging oder vielmehr, wie es in ihm dabei zu-
ging -- denn seine Kontrolle war ganz ausgeschaltet,
viele seiner Erkenntnisse waren einfach Aufsitzer,
Selbstaufsitzer -- dies erhellt am deutlichsten aus
dem Kapitel u? ber das Judentum. Weininger entdeckt
eines Tages, dass die Juden insgesamt, M und W,
eine Reihe von unscho? nen und unangenehmen Eigen-
schaften haben, wie er sie urspru? nglich an W kon-
statiert hat. Das Na? chstliegende wa? re nun wohl ge-
wesen, an seiner Charakterisierung von W irre zu
S wob oda, Otto Weiningers Tod. 3
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? werden. Was sind das fu? r wesentliche Merkmale
von W, die man auch, und genau so, bei M einer
andern Nation vorfindet? Allein Weininger weiss sich
zu helfen. W ist ihm ja schon la? ngst nicht das
unter uns wandelnde weibliche Wesen, sondern ein
aus den Tatsachen herauspra? parierter Begriff; W
ist nicht das Weib, sondern das Weibliche. Er geht
nun noch einen Schritt weiter: W ist auch nicht
das Weibliche, sondern eine Idee im Sinne Piatos;
darum kann auch M, kann auch ein ganzes Volk
so wie W geartet sein; es ist dann eben die sinn-
liche Erscheinung der platonischen Idee. Die Juden
sind nicht die einzigen, auch die Engla? nder haben
an jener Idee Teil! Man sieht hier wieder, wie ver-
derblich Weininger seine Kenntnisse wurden. Ein
anderer an seiner Stelle ha? tte konstatiert, dass da
etwas nicht stimmt; und er ha? tte weiter nachgeforscht
und seine Gedanken den Tatsachen besser angepasst.
Allein Weininger weiss sich viel schneller Rat. Im
Handumdrehen hat er das Allerunvereinbarste zu
einem System verbunden, dessen streng logischer
Aufbau und dessen a? usserliche Gefa? lligkeit geradezu
bestechend wirken. An der Geschicklichkeit, mit der
Weininger seine Wahrheiten oft zusammensetzt, kann
man auch dann seine Freude haben, wenn man
ihren vollsta? ndigen Unwert durchschaut. Ja, gerade
erst dann. Wie u? berhaupt am ganzen Buch nur der-
jenige das richtige Vergnu? gen hat, dem es nicht
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 35
gefa? hrlich ist. Vieles ist geradezu ko? stlich zu ge-
niessen, wenn man sichs nicht in dem feierlichen
Offenbarungstone liest, in dem es vorgetragen wird.
Was fu? r eine feine Unterhaltung haben wir nicht
oft gehabt mit solchen spielerischen, natu? rlich gar
nicht ernst gemeinten Kombinationen, mit unserem
Gedankenkaleidoskop! Weiningers Fehler und Un-
glu? ck war nur, dass er solche Gebilde spa? terhin
ernst, furchtbar ernst nahm. So erschienen ihm auch
seine A? usserungen u? ber das Judentum als letzte,
tiefste Wahrheit. Die Wahrheit war aber natu? rlich
nur die, dass er die Juden ebensowenig ausstehen
konnte wie die Frauen; das Judentum ebensowenig
wie W, wu? rde Weininger verlangen.
Weininger hasste das Judentum; was er darunter
verstand oder wenigstens verstehen wollte, war aber
nicht ein Nationalcharakter, sondern wieder eine
platonische Idee, an welcher demgema? ss auch Arier
teilhaben konnten -- so half er sich u? ber die fatale
Beobachtung hinweg, dass auch Arier ha? ufig die
Eigenschaften aufweisen, die ihm an den Juden un-
angenehm waren. Sein Hass suchte nun nach Nah-
rung. Er fand die Juden mit W a? hnlich, weil er ein
Interesse daran hatte, sie ebenso schlecht wie W
zu finden.
Lettern ermessen -- dass die Platon'sche Unter-
scheidung vom Seienden und Nicht-Seienden voll-
kommen auf M und W passe: Das Weib ist nicht
nur nichts, sondern u? berhaupt nicht.
Diese Verquickung philosophischer Anschau-
ungen mit dem Problem der Geschlechter hat durch-
aus den Charakter eines Witzes in dem fru? her er-
o? rterten Sinne. Ich kann mir sehr gut vorstellen,
dass jemand darauf mit lebhafter Heiterkeit reagiert.
Viele freilich werden bei jener trostlosen Offenbarung
u? ber W eine lebhafte Gefu? hlsbefriedigung empfinden;
sie werden erleichtert aufatmen, freudig bewegt, dass
endlich einer gekommen ist, ? der es ihnen (W na? m-
lich) gesagt hat". Das ist freilich eine etwas ver-
da? chtige Art, Erkenntnis zu begru? ssen. Erkenntnis
soll den Geist befriedigen, aber nicht das Gemu? t.
Allerdings mu? sste sie dazu auch dem Geist ent-
stammen, nicht einem verbitterten Herzen.
Ich habe fru? her dargelegt, unter welchen Um-
sta? nden es besonders ha? ufig zu anorganischen,
witzigen Seelengebilden kommt: wenn na? mlich mit
diesen Gebilden ein lebhaftes Gemu? tsbedu? rfnis --
die unterdru? ckten sind die lebhaftesten -- befriedigt
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 25
werden soll. Dieses Bedu? rfnis liegt nun bei Weininger
ganz offen zutage. Ein anderer an seiner Stelle --
und wie viele nicht in seinem Alter! -- ha? tte ein-
fach gesagt: Die Weiber sind mir Luft. Etwas anderes
wollte Weininger auch gar nicht sagen. Aber er
konnte es, zu seinem Unglu? ck, viel scho? ner sagen.
Die banale vera? chtliche Phrase verband sich unter
dem dru? ckenden Bedu? rfnis abzureagieren mit seinem
philosophischen Wissen und so konnte er seinem
Groll in der Art Ausdruck geben, dass er sagte:
W ist u? berhaupt nicht. Mit der U? bertragung der
Platon'schen Kategorie auf W war aber noch eines
gewonnen: Wer behauptet, die Weiber seien ihm
Luft, der behauptet etwas Subjektives; wer behauptet,
sie seien nicht, etwas Objektives. Das war es, was
Weininger ein so offenkundiges Triumphgefu? hl be-
reitete: Er konnte beweisen, wo die andern nur
schimpfen konnten. Einen Schimpf kann man zuru? ck-
geben, vor einer wissenschaftlich bewiesenen Tat-
sache dagegen muss jede Gegenrede verstummen.
Dass Weininger kein uninteressierter Denker
war, lehrt wohl ein Blick in seine Schriften. Ein
Denker darf aber kein anderes Ziel vor Augen haben
als Denkergebnisse. Jedes Interesse -- Ehrgeiz,
Liebe, Hass, Streben aller Art -- fa? lscht das Denken
unfehlbar in der geschilderten Weise. Unter dem
Druck eines Gemu? tsbedu? rfnisses ko? nnen zwar allerlei
pra? chtige, bestechende, blendende Bildungen zu-
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 26
sta? nde kommen, aber keine echten Gedanken. Es
kommt dabei wohl eine Wahrheit heraus, aber nicht
u? ber die Welt, sondern u? ber eine leidende Seele.
Was die Bildung unechter Gedanken bei Weininger
begu? nstigte, das war sein ungewo? hnlicher Reichtum
an Kenntnissen aller Art. Dieser Reichtum ermo? g-
lichte ihm massenhafte, verfu? hrerische Kombinationen
zwischen den Vorstellungen ganz entlegener Ge-
biete; er war in allen Fa? chern der exakten Natur-
wissenschaft bewandert, er wusste in medizinischen
Fragen ausgezeichnet Bescheid, von den Geistes-
wissenschaften gar nicht zu reden. Setzte sich nun
in ihm aus irgend einem Gefu? hlsmotiv eine Meinung
fest, so war im Handumdrehen eine Kombination
von Vorstellungen da, welche ihm seine Meinung
bewies. Besonders in den ? letzten Dingen" ist dieses
Verfahren deutlich zu konstatieren: wie ihm ganz
a? usserliche Analogien zwischen zwei Tatsachen als
Beweis einer vorgefassten Meinung genu? gen. Solche
traumartige Bildungen hatten fu? r ihn die Evidenz
von unumsto? sslichen Wahrheiten.
Dies wird nun viele bei einem Geist von so
grosser Genialita? t, also von der Fa? higkeit zu wirk-
lichen Wahrheiten, befremden. Man hat Weininger
sehr unrecht getan, wenn man unter Hinweis auf
seine witzartigen Gedanken, seinem gesamten Denken
jeglichen Erkenntniswert absprach. Davon kann keine
Rede sein. Man muss da scharf scheiden und es
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 27
la? sst sich, wie ich gezeigt habe, auch scharf scheiden.
Allein viele seiner Behauptungen und gerade solche,
auf die er am meisten hielt, sind vo? llig unhaltbar
und da fragt es sich, wie denn ein Mensch von
solcher Tiefe und solchem Scharfsinn zu ihnen ge-
langen konnte. Die Antwort ist wieder durch die
Tatsache schon mitgegeben, dass Weininger bei
seinem Denken ha? ufig seelische Interessen ver-
folgte. Solche Interessen fa? lschen nicht nur das
Denken," sondern sie verblenden auch gegen diese
Fa? lschung. Weininger hing gerade am Unhalt-
barsten mit der gro? ssten Liebe; die vermeintlichen
Wahrheiten befriedigten ihm eben seine Gemu? ts-
bedu? rfnisse und diese u? berwogen in den letzten
Jahren seines Lebens weitaus die rein geistigen Be-
du? rfnisse. Die Wonne, welche ihm seine Gedanken
verschafften, nahm er als eine Bu? rgschaft ihres Wahr-
heitsgehaltes hin; er war von ihrer Wahrheit u? ber-
zeugt, weil sie ihm Freuden spendeten, so gross wie
sie nur dem Gemu? t zuteil werden. Es erging ihm
wie den Eltern, die von der Gu? te und Gescheitheit
ihrer Kinder u? berzeugt sind, weil sie an ihnen Freude
haben. Interessen fa? lschen das Denken und tru? ben
das Urteil, vor allem die Selbstbeurteilung. Weininger
war fu? r einen reinen Denker, wie seine Probleme
einen erforderten, viel zu jung. Es war, in seinem
Alter, eine Vermessenheit, die reine Wahrheit finden
zu wollen, eine Vermessenheit, die er mit dem Tode
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 28
gebu? sst hat; ha? tte er die U? berzeugung zu opfern ver-
mocht, dass seine Anschauungen durchwegs die reine
Wahrheit enthalten, so wa? re er leicht zu retten ge-
wesen. Aber der erste Fehler, die Vermessenheit, zog
den zweiten Fehler, den Starrsinn, nach sich und
so war dem U? bel schliesslich nicht mehr zu steuern.
Ich werde spa? ter noch ausfu? hrlich klarlegen,
dass Weininger eigentlich an einem Irrtum zugrunde
gegangen ist. Dieselben Gemu? tszusta? nde, welche
aus seinen Vorstellungen ku? hne und bestechende
Kombinationen auffu? hrten, verleiteten ihn zum un-
bedingten Glauben an diese Kombinationen. Er
konnte von den Ideen, die ihm als go? ttliche Ein-
gebungen erschienen, wa? hrend sie nur eine Mache
der Da? mone in seinem Herzen waren, nicht mehr
los, er zwang sein Leben in Regeln, fu? r die es
nicht geschaffen war, bis er schliesslich dem Glauben
an sich selber zum Opfer fiel.
Eine Folge der Gemu? tsinteressen ist auch die
stellenweise so gla? nzende Dialektik in ? Geschlecht
und Charakter". Nichts fu? hrt zu einer so deutlichen
Charaktersierung des Stils, als das Verha? ltnis eines
Autors zu seinen eigenen Gedanken. Advokatorische
Beredsamkeit und namentlich Scharfsinn bekundet
immer nur der Interessierte, der, wie es zum In-
teressierten schon geho? rt, Gegner befu? rchtet und
deren Einwendungen im vorhinein beka? mpft. Die
Wahrheit tritt in ganz schlichtem Gewa? nde vor die
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 29
Welt hin. Es bedarf keiner Fingerzeige und Aus-
rufe, damit man sie bemerkt und achtet. Fu? r eine
Wahrheit echauffiert sich ihr Autor nie; sein In-
stinkt sagt ihm, dass sie ihren Weg so sicher nehmen
wird wie ein wohlgeratenes Kind. Anders ist es
bei den auf die angegebene Weise entstehenden
Scheinwahrheiten. Sie sind von vornherein nichts als
tru? gerische Kombinationen, es ist daher nur konse-
quent, wenn man viel Mu? he aufwendet, um sie ins
rechte Licht zu setzen.
Fu? r die Beurteilung von Weiningers Hauptwerk
ist nicht zuletzt dessen Wirkung von Wichtigkeit.
Diese Wirkung la? sst sich eigentlich erst auf Grund
der eben vorgenommenen Unterscheidung zwischen
echten und Scheinwahrheiten verstehen. Scheinwahr-
heiten sind nichts anderes als Gemu? tsa? usserungen,
die demgema? ss auch vor allem auf das Gemu? t des
Lesers, nicht auf seinen Verstand wirken. So stu? rmische
Zustimmung und Ablehnung, wie sie Weiningers An-
sichten fanden, werden einer Einsicht nie zuteil.
Einsichten rufen u? berhaupt nie eine Parteiung
hervor; sie stossen ho?
chstens auf zeitweiligen Wider-
stand oder, wie man optimistischer sagen ko? nnte,
sie brauchen eine Inkubationsfrist. Weininger hat
dagegen, mit einem Schlage, die einen entzu? ckt, die
andern empo? rt. Gleichgestimmte haben ihn als
Befreier von schwerlastendem Gemu? tsdruck begru? sst,
Andersgestimmte als Seelensto? refried zuru? ckge-
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 30
wiesen. Durch eine wirkliche Einsicht werden die
Gemu? ter nicht in Aufruhr gebracht; durch eine
falsche Einsicht wird der Aufruhr einer Seele vielen
Seelen mitgeteilt, so ist der Sachverhalt.
Weiningers Buch ist furchtbar genannt worden.
Auch das ist sehr bezeichnend. Es gibt keine furcht-
baren Wahrheiten. Die Wahrheit wirkt immer be-
lebend, wohltuend. Die Wahrheit, sei 's nun u? ber eine
naturwissenschaftliche Frage oder u? ber den er-
habensten Gegenstand, ist ein Teil der go? ttlichen
Offenbarung, nicht im Sinn irgend einer kirch-
lichen Dogmatik, sondern naturphilosophisch ge-
nommen; es widerspricht dem Begriff der Wahr-
heit, dass sie wie eine furchtbare Enthu? llung wirkt.
Dass viele von Weiningers Behauptungen geradezu
niederdru? ckend wirken, ist zweifellos, aber nur, weil
sie unter der Etikette von Erkenntnissen die Ge-
fu? hle einer zu Tode verzweifelten Seele a? ussern.
Nicht von der Wahrheit kommt die schaurige Ka? lte,
die einem aus manchen Seiten von ? Geschlecht
und Charakter" entgegenweht, sondern von der
Selbstmordstimmung, in der diese Seiten geschrieben
sind und die sich dem Leser unwillku? rlich mitteilt.
Das fehlte noch, dass man die Forschung betreiben
muss unter Zittern und Bangen vor dem, was
herauskommt! Nein, die Forschung ist der fro? h-
lichste Gottesdienst. Und die Erkenntnis, die dabei
zutage kommt, ist unter allen Umsta? nden tro? stlich
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 31
und heilkra? ftig. Und wenn sie es nicht ist, wenn
sie krank und lebensu? berdru? ssig macht, so verra? t
sie dadurch ihre unechte Abkunft.
Man kann den Tadel, welchen ich hier gegen
gewisse Teile von Weiningers Werk erhoben habe,
in ein einziges Wort zusammenfassen: es ist zum Teil
rein perso? nlich. Nach einem richtigen Gedanken-
werk darf man keine Biographie schreiben ko? nnen.
Man soll nicht einmal ahnen ko? nnen, wie dem Ver-
fasser dabei zumute war, geschweige denn zur
Annahme bestimmter Erlebnisse gelangen. Am Werke
des Denkers sollen Zusta? nde den allergeringsten
Anteil haben. Der Denker soll sich hierin vom
Ku? nstler unterscheiden, bei dem die Verwendung des
Perso? nlichen zum Fach geho? rt, dem es ja vor allem
darum zu tun ist, die Welt mit seiner Perso? nlichkeit
bekannt zu machen, der sich aber auch nicht einbildet,
die reine, allgemein gu? ltige Wahrheit zu sagen. Ein
philosophisches Werk soll nicht einmal durch den Ton,
in dem es geschrieben ist, ein Bekenntnis ablegen.
Den Freudenaffekt, das frisch fro? hliche svgrjxa darf
man daraus vernehmen, sonst nichts. Pru? ft man Wei-
ningers Werk auf diese Regel hin, so findet man,
dass es vielfach nur grandiose gelehrte Variationen
entha? lt u? ber Themen, die andere in lyrischen Ge-
dichten, Dramen und Symphoniesa? tzen behandeln.
Ich habe u? ber alle diese Punkte mit Weininger
seinerzeit viel gesprochen. Er konnte es -- aller-
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 32
dings erst spa? ter -- nicht leiden, wenn man den
Inhalt eines Werkes psychologisch erkla? rte, das heisst
aus den Lebensschicksalen seines Verfassers. Nament-
lich an ein Mal erinnere ich mich, wo er sehr heftig
wurde, als ich dieses Verfahren auf Nietzsche an-
wandte. Nun sind ja Erlebnisse eine unbedingte Vor-
aussetzung fu? r geistige Produktion irgendwelcher
Art. Der Gedanke ist der Abschluss des Erlebnisses
und sein Ertrag. Dieser Hergang ist ganz in der
Ordnung. Unstatthaft ist es nur, dass das Erlebnis
eine fremde Gedankengruppe beeinflusst. Wenn
jemand durch ein gewaltiges Elementarunglu? ck zu
Gedanken u? ber das Weltregiment angeregt wird,
so ist das natu? rlich; wenn er aber, etwa infolge
unglu? cklicher Liebe, theologische Spekulationen be-
ginnt, die fu? r Gott ungu? nstig ausfallen, so ist das
verschroben. Ein Werk psychologisch erkla? ren, heisst
ja nicht, ihm jeglichen Wert absprechen, sondern
nur, jenen Faktor aufsuchen und eliminieren, der
mit der Wahrheit absolut nichts zu tun hat.
Es wa? re unbillig, von jedem Denker eine innere
Unabha? ngigkeit zu verlangen, wie sie nur sehr
wenigen gnadenweise zuteil wird. Wenn aber jemand
verlangt, dass man alle seine Anschauungen als un-
bedingte Wahrheit hinnimmt, dann ist man wohl nach-
zuforschen berechtigt, unter welchen Bedingungen
etwa seine ? Wahrheiten" entstanden sind; und man
wird gerade in diesem Fall auch immer Bedingungen
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 33
finden. Bei Werken der Kunst ist die psychologische
Forschung -- wenn sie als wesentlicher Bestandteil
vertieften Kunstgeniessens ausgegeben wird -- aller-
dings unstatthaft; sie ist dort nichts als eine wissen-
schaftlich drapierte besondere Art von Lu? sternheit.
Aber bei einem Denker zeugt es von schlechtem
Gewissen, wenn er sich gegen eine psychologische
Untersuchung verwahrt. In der Tat, wenn beim
Ku? nstler das Erlebnis, etwa durch einen spa? ter publi-
zierten Briefwechsel, offenbar wird, so a? ndert das
an der Wertung des Kunstwerkes nicht das ge-
ringste; dagegen verlieren eines Mannes Gedanken
u? ber die Geschlechtsliebe sehr an Kredit, wenn aus
nachgelassenen Rezepten hervorgeht, wie schlechte
Erfahrungen er im Leben gemacht hat. Unglu? ck
macht manchmal weise; noch o? fter aber beschra? nkt
und ungerecht.
Wie Weininger bei seinen Forschungen oft zu-
wege ging oder vielmehr, wie es in ihm dabei zu-
ging -- denn seine Kontrolle war ganz ausgeschaltet,
viele seiner Erkenntnisse waren einfach Aufsitzer,
Selbstaufsitzer -- dies erhellt am deutlichsten aus
dem Kapitel u? ber das Judentum. Weininger entdeckt
eines Tages, dass die Juden insgesamt, M und W,
eine Reihe von unscho? nen und unangenehmen Eigen-
schaften haben, wie er sie urspru? nglich an W kon-
statiert hat. Das Na? chstliegende wa? re nun wohl ge-
wesen, an seiner Charakterisierung von W irre zu
S wob oda, Otto Weiningers Tod. 3
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? werden. Was sind das fu? r wesentliche Merkmale
von W, die man auch, und genau so, bei M einer
andern Nation vorfindet? Allein Weininger weiss sich
zu helfen. W ist ihm ja schon la? ngst nicht das
unter uns wandelnde weibliche Wesen, sondern ein
aus den Tatsachen herauspra? parierter Begriff; W
ist nicht das Weib, sondern das Weibliche. Er geht
nun noch einen Schritt weiter: W ist auch nicht
das Weibliche, sondern eine Idee im Sinne Piatos;
darum kann auch M, kann auch ein ganzes Volk
so wie W geartet sein; es ist dann eben die sinn-
liche Erscheinung der platonischen Idee. Die Juden
sind nicht die einzigen, auch die Engla? nder haben
an jener Idee Teil! Man sieht hier wieder, wie ver-
derblich Weininger seine Kenntnisse wurden. Ein
anderer an seiner Stelle ha? tte konstatiert, dass da
etwas nicht stimmt; und er ha? tte weiter nachgeforscht
und seine Gedanken den Tatsachen besser angepasst.
Allein Weininger weiss sich viel schneller Rat. Im
Handumdrehen hat er das Allerunvereinbarste zu
einem System verbunden, dessen streng logischer
Aufbau und dessen a? usserliche Gefa? lligkeit geradezu
bestechend wirken. An der Geschicklichkeit, mit der
Weininger seine Wahrheiten oft zusammensetzt, kann
man auch dann seine Freude haben, wenn man
ihren vollsta? ndigen Unwert durchschaut. Ja, gerade
erst dann. Wie u? berhaupt am ganzen Buch nur der-
jenige das richtige Vergnu? gen hat, dem es nicht
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-08-19 08:37 GMT / http://hdl. handle. net/2027/njp. 32101068184017 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-us-google
? 35
gefa? hrlich ist. Vieles ist geradezu ko? stlich zu ge-
niessen, wenn man sichs nicht in dem feierlichen
Offenbarungstone liest, in dem es vorgetragen wird.
Was fu? r eine feine Unterhaltung haben wir nicht
oft gehabt mit solchen spielerischen, natu? rlich gar
nicht ernst gemeinten Kombinationen, mit unserem
Gedankenkaleidoskop! Weiningers Fehler und Un-
glu? ck war nur, dass er solche Gebilde spa? terhin
ernst, furchtbar ernst nahm. So erschienen ihm auch
seine A? usserungen u? ber das Judentum als letzte,
tiefste Wahrheit. Die Wahrheit war aber natu? rlich
nur die, dass er die Juden ebensowenig ausstehen
konnte wie die Frauen; das Judentum ebensowenig
wie W, wu? rde Weininger verlangen.
Weininger hasste das Judentum; was er darunter
verstand oder wenigstens verstehen wollte, war aber
nicht ein Nationalcharakter, sondern wieder eine
platonische Idee, an welcher demgema? ss auch Arier
teilhaben konnten -- so half er sich u? ber die fatale
Beobachtung hinweg, dass auch Arier ha? ufig die
Eigenschaften aufweisen, die ihm an den Juden un-
angenehm waren. Sein Hass suchte nun nach Nah-
rung. Er fand die Juden mit W a? hnlich, weil er ein
Interesse daran hatte, sie ebenso schlecht wie W
zu finden.